Grundvoraussetzung einer optimalen Förderung ist eine aussagekräftige, also fachlich fundierte Diagnostik, die sich für uns grundsätzlich aus drei verschiedenen Bereichen zusammensetzt: erstens eine gründliche anamnestische Datenerhebung, zweitens die Durchführung von Begabungs- und einschlägigen, wissenschaftlich abgesicherten Fachtests (Schulleistungstests) sowie drittens eine gezielte Verhaltensbeobachtung, bei der die Fertigkeiten und Denkstrategien eines Kindes diagnostiziert (i. e. Förderdiagnostik) und die Ergebnisse aller drei eingesetzten Diagnose-Tools dann zu einer gesamthaften Lernausgangslage des Schülers verdichtet werden. Bereits hier wird deutlich, dass eine profunde und zuverlässige Dyskalkulie-Diagnostik mehrdimensional (multiaxial) sein muss und sogar Determinanten wie Sprachentwicklung, visuell-räumliches Vorstellungsvermögen, generelles Problemlösungsverhalten oder die allgemeine Aufmerksamkeit mitberücksichtigen sollte, obwohl ein kausaler Zusammenhang von Defiziten in „nicht-numerischen Bereichen“ mit Rechenstörungen empirisch bis heute nicht eindeutig belegt ist (Landerl et al, 2017, S. 154).
Schulnote ist Form von Diagnostik
Wichtig zu wissen: bereits in der Schule wird eine Form von Diagnostik betrieben, nämlich, wenn in Klassenarbeiten oder aber aufgrund der mündlichen Mitarbeit der Lehrer ermittelt, was genau der jeweilige Schüler kann bzw. noch nicht kann und dies dann in einer „harten“ Halbjahres- oder Schuljahresendnote zusammenfasst. Schüler und Eltern wissen dann, wo das Kind steht und in wieweit er das jeweilige Klassenziel erreicht hat. Auch der Lehrer kann auf diese Weise für die Gesamtheit seiner Schüler ermitteln, ob und wie viel von dem Lehrstoff gemäß Lehrplan bei der Klasse überhaupt angekommen ist und er kann darüber hinaus mittels vorliegender Noten sein Schüler miteinander vergleichen, leistungsstärkere von schwächeren unterscheiden usw.
Die in praxi verwendete anerkannte standardisierte Tests, so zum Beispiel Intelligenztests (ehem. HAWIK bzw. WISC) und auch Rechentests (ZAREKI; DEMAT oder HRT 1-4 usw.) ähneln der o. g. Form von Diagnostik stark: Der Klient bekommt bestimmte Aufgaben und am Ende wird festgestellt, welche er richtig gelöst hat und welche nicht, woraufhin durch den Vergleich mit sog. Testnormen eruiert wird, „wo“ genau das Kind im Verhältnis zu Gleichaltrigen bzw. Gleichaltrigen desselben Schultyps steht, was dann durch Prozentränge ausgedrückt werden kann.
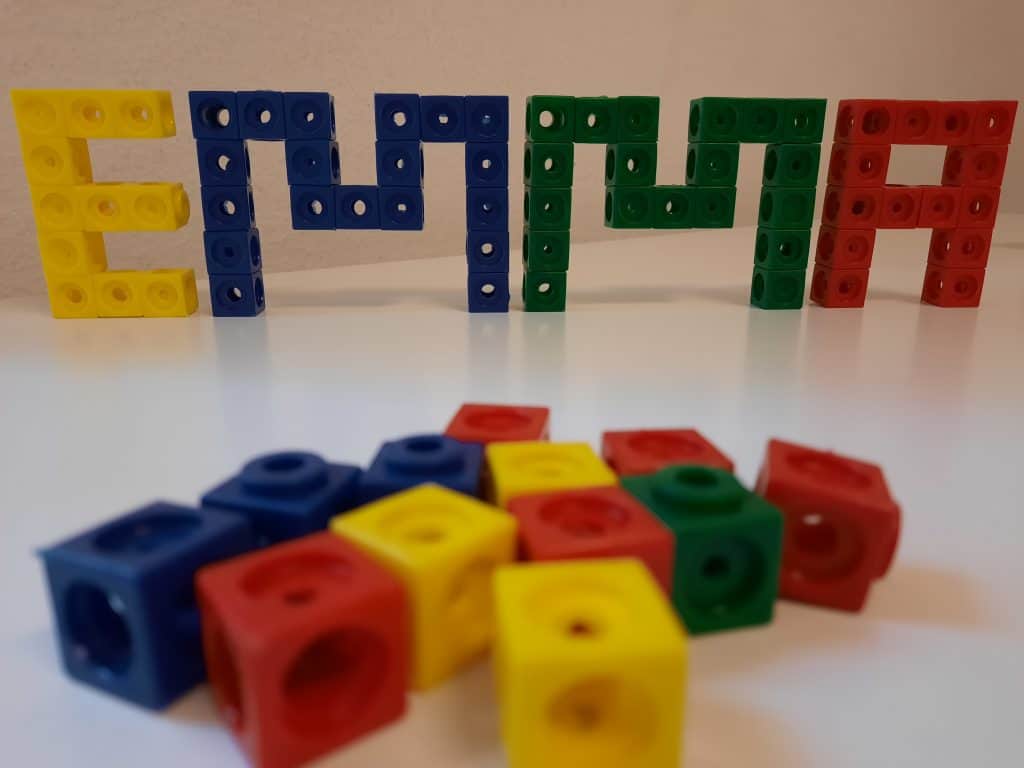
Im Großen und Ganzen unterscheiden sich aber die o. g. Testungen von den Schulnoten aufgrund ihrer Standardisierung: Alle getesteten Schüler erhalten dieselben Aufgaben und nicht etwa nur solche, die vorher im Unterricht auch behandelt worden sind und der spätere Vergleich findet nicht nur innerhalb der konkreten Schulklasse, sondern auf der Basis einer teils sehr großen Grundgesamtheit mit vielen Tausend Schülern derselben Jahrgangstufe statt. Mögliche „Fischteicheffekte“ (der Schüler hat in seiner Klasse sehr viele leistungsschwachen Schülern und seine Note ist deshalb relativ gut et vice versa) ist somit ausgeschlossen und der Abgleich der Anzahl richtiger Lösungen des einen Schülers mit der anderer steht auf einer breiteren Basis und ist damit „gerechter“.
Kleiner Einschub am Rande: Wir sehen immer wieder aufmerksame Eltern oder Lehrer, die frühzeitig, also sofort bei Auftreten erster Verdachtsmomente in Richtung Rechenschwäche reagieren und dann in einer wie oben beschrieben fachgerechten Einzelfalldiagnostik diesem Verdacht nachgehen lassen, so z. B. von einem Kinder- und Jugendpsychater, Psychologen, Kinderarzt oder der städtischen Schulberatungsstelle. Meistens ist jedoch der Anlass, aus dem Schüler bei einem Anbieter für Dyskalkulie-Therapie vorstellig werden, eine sehr schlechte Schulnote in Mathematik, die sich ebenfalls in den durchgeführten standardisierten Test-Verfahren nachträglich bestätigt. Solche Kinder bekommen zuerst Hilfe durch ihre Eltern, oft in Zusammenarbeit mit den Lehrern, besuchen meistens einen zusätzlichen Förderunterricht der Schulen oder gehen zu einem Nachhilfeanbieter. Einigen Kindern kann auf diese Weise tatsächlich geholfen werden, aber was ist mit denen, die sich nicht verbessern und jahrelang auf der Stelle treten?
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass diesen Kindern in puncto Diagnostik eine Standard-Diagnostik nicht hilft, die feststellt bzw. erneut bestätigt, dass große Schwierigkeiten im mathematischen Bereich bestehen oder dass viel weniger richtige Ergebnisse beim Rechnen erzielt als wurden, als der Durchschnitt der Kinder, die genauso alt sind und denselben Schultyp besuchen. Aber nur solche Beurteilungen ermöglicht der Einsatz dieser herkömmlichen Testdiagnostik mittels standardisierter Tests. Und betroffene Eltern reagieren dann teilweise mit Unverständnis und äußern: „Der Test meines Sohnes ist aber schlecht ausgefallen, aber das wussten wir ja schon, dass er schlecht in Mathematik ist, das ist ja nichts Neues!“ Und natürlich haben diese Eltern Recht, umgekehrt ist es aber schlecht vorstellbar, dass ein Schüler mit schlechten oder sehr schlechten Leistungen in Mathematik in den oben genannten Tests aber positiv abschließt! Wie wir sehen, kommen wir so nicht weiter!
Förderdiagnostik versus Schulleistungstests
Die von uns eingesetzte Diagnostik muss sich deshalb unterscheiden und zusätzlich auf etwas anderes abzielen. Wir wollen nämlich die Frage beantworten, woran genau es liegt, dass der Schüler, der zu uns kommt, immer wieder deutlich mehr falsche Ergebnisse erzielt als seine Mitschüler. Und darüber hinaus versuchen wir herauszubekommen, warum alle bisherigen Maßnahmen, den Schüler zu verbessern, fehlgeschlagen sind und wenig bis gar nichts gebracht haben.
Im Speziellen: Unsere Förder-Diagnostik als quasi dritter flankierender Baustein der bei uns praktizierten Gesamtdiagnostik beurteilt also nicht die Lösungen, die der Schüler erzielt hat (Kriterium „richtig“ oder „falsch und fasst sie dann zu einem Test-Wert bzw. Prozentrang zusammen), sondern wir beschäftigen uns mit und ermitteln die Denkprozesse, Denkstrategien und mathematischen Fertigkeiten, die das Kind zu seinen Ergebnissen geführt haben.
Wie wir wissen, führen falsche Lösungsstrategien nicht zwangsläufig bei allen Aufgaben auch zu falschen Lösungen, sondern bei einigen, manchmal recht vielen, auch zu richtigen Ergebnissen – man kann also vom richtigen Ergebnis nicht darauf schließen, dass die Lösungsstrategie, die das Kind zu diesem Ergebnis geführt hat, richtig ist. Beispielsweise wird ein Kind bei der Aufgabe 8 + 7 auch „zählend“ anstatt rechnend [8 + 2 = 10 + 5 = 15 {Rechnen bis zum Zehner} oder 8 + 8 = 16 – 1 = 15 {Verdoppeln/Nachbaraufgaben}] zu der richtigen Lösung kommen, allerdings würde man auf diese Weise feststellen, dass es sich beim Klienten um einen sog. „hartnäckigen Zähler“ handelt – trotz des korrekten Ergebnisses und man müsste in der Dyskalkulietherapie exakt dort ansetzen. Umgekehrt hat gerade auch das rechenschwache Kind, wenn es ein falsches Ergebnis ausgerechnet hat, nicht nur falsch gedacht, sondern in der Regel war einiges, wenn nicht vieles, an seinem Denkprozess richtig.
Daher ist es ist notwendig zu eruieren, welche genauen Denkschritte das Kind korrekt erledigt hat, und welche dann zu dem falschen Ergebnis geführt haben. Und genau diese Erkenntnis geht über das Urteil „richtig“ oder „falsch“ (und mehr ermittelt ein standardisierter Test oder eine benotete Klassenarbeit eben nicht) weit hinaus. Unsere Diagnostik eruiert, wie der Schüler „zahlentechnisch“ unterwegs ist, so dass es bei ihm im Fach Mathematik zu solch großen Schwierigkeiten bekommen ist. Wir bestimmen, wo in seinem Denken genau seine Schwächen liegen, und wo er die mathematischen Kompetenzen hat, auf denen eine erfolgreiche Förderung aufbauen kann. Wir ermitteln also das Potenzial des Schülers, um in der späteren Intervention zunächst auf seinen Stärken anzusetzen und ihm dadurch kurzfristige Erfolgserlebnisse zu vermitteln (Arbeiten an der 0-Fehlerlinie).
Als kleinen Einschub betonen wir aber auch, dass auch der emotionale Kontext, in welchem sich das Kind befindet, keines falls ignoriert werden sollte – da z. B. die Angst des Schülers vor dem Fach Mathematik und die speziellen Bedingungen, die diese Angst hervorrufen, erkannt werden müssen.
In noch einer weiteren Hinsicht zielt unsere Diagnostik darauf, das Potenzial des Kindes zu erkennen, und nicht bloß seinen aktuellen Leistungsstand. Da wir nicht nur die Ergebnisse registrieren, die das Kind bei den vorgelegten Aufgaben erzielt, sondern gleichzeitig mit ihm im Dialog über seine Lösungsstrategien sprechen (sog. Diagnostisches Gespräch), können wir ihm auch schon während der Förderdiagnostik Hilfestellungen geben, wie z. B. in indirekten Hinweisen und Vorschlägen, hinführenden Fragen oder anschaulichen Demonstrationen der jeweiligen Lösungen. Auf diese Weise prüfen wir auch das Entwicklungspotenzial des Kindes: die „Dynamik“ seines Intellekts, seine Flexibilität, sein Lernpotenzial, seine Fähigkeit, aus Erfahrungen und Unterstützung Nutzen zu ziehen.
Wissenschaftliche Basis der Förderdiagnostik
Zusammenfassend und abschließend: Oberstes Ziel unsere Förderdiagnostik ist es, nicht bei den gezeigten Symptomen des Schülers (z. B. ein falsches Ergebnis als sichtbares Ergebnis) stehen zu bleiben, sondern die dahinterliegenden Ursachen der Fehler aufzuspüren. Wir führen also keine rein ergebnisorientierte Fehlersuche durch, sondern sind stets auf der Suche nach den spezifischen Denkmustern und Lösungsstrategien. Wissenschaftlich fundiert ist diese Vorgehensweise übrigens aufgrund der Theorien von Piaget und Aebli, die nachgewiesen haben, dass alle mathematischen Denkprozesse beim Menschen von konkreten (Mengen-)Handlungen ausgehen, die dann sukzessive verinnerlicht werden und sich dann zu inneren Vorstellungsbildern (sog. Grundvorstellungen) bzw. zu abstrakten, flexiblen Rechenstrategien ausbilden (Hasenbein, 2017, S. 4).
Im Beitrag verwendete Fachliteratur
Landerl, K. / Vogel, S. / Kaufmann, L.: (2017): Dyskalkuie, 3. Auflage, München/Basel: Ernst Reinhardt Verlag
Hasenbein, K.: (2017): Aus Fehlern lernen – Förderdiagnostik, Braunschweig: Westermann, Schroedel, Diesterweg



